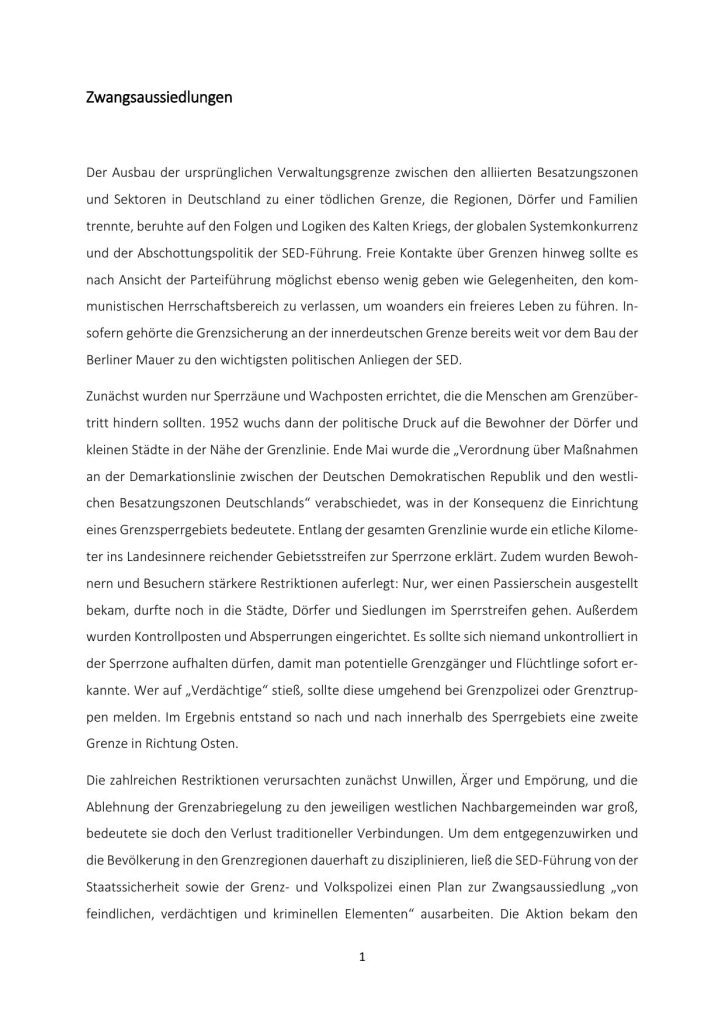Auch schon weit vor dem Mauerbau in Berlin 1961 war es der SED-Führung wichtig, die innerdeutsche Grenze zu schließen. 1952 wurde die Einrichtung eines Grenzsperrgebiets verfügt. Das war ein mehrere Kilometer breiter Landstrich, der nur noch mit besonderer Erlaubnis betreten werden durfte. Für die Bewohner von Dörfern und Kleinstädten in dieser Sperrzone entstand damit eine Grenze, die sie quasi auch nach Osten abriegelte.
In zwei großen Zwangsaussiedlungsaktionen mit insgesamt rund 12 000 Zwangsausgesiedelten wurden Menschen vertrieben, deren Besitz bzw. Wohnraum geschleift oder übernommen werden sollte oder die als regimekritisch bzw. „politisch unzuverlässig“ eingestuft wurden. Die erste Aktion im Jahr 1952 erhielt die Bezeichnung „Aktion Ungeziefer“, die zweite im Oktober 1961 „Aktion Kornblume“. Hinzu kamen einzelne Zwangsaussiedlungen, die an zahlreichen Orten zu allen Zeiten stattfanden.
Die Vertriebenen wurden meist fern der Heimatregion angesiedelt, hatten dort anfangs zumeist miserable Lebensbedingungen und galten gesellschaftlich als stigmatisiert. Die Menschen, die dagegen bleiben durften, waren nachhaltig eingeschüchtert. Ein Klima der Angst und des Misstrauens beherrschte den Sperrstreifen, denn niemand wollte sein Haus und Hof bzw. die angestammte Heimat verlieren.