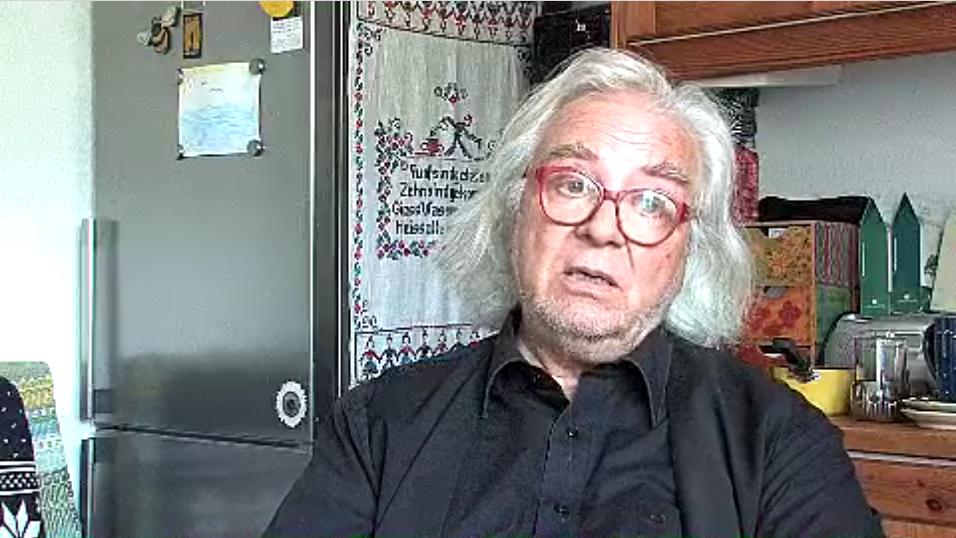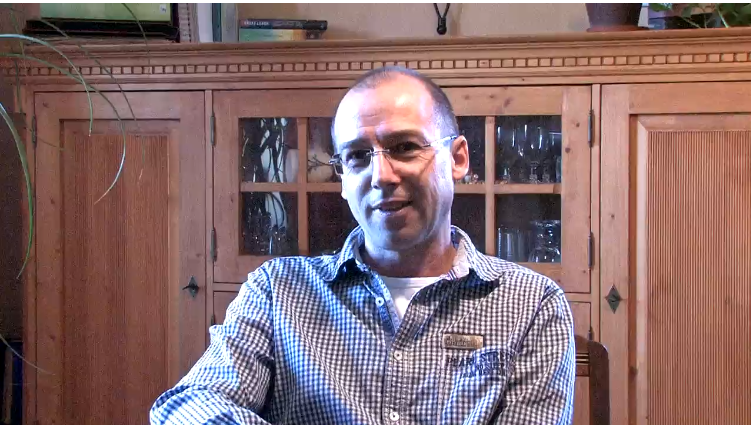In Diktaturen mit einem totalitären Herrschaftsanspruch gelang es nie dauerhaft, Widerspruch und Opposition gegen die vorhandenen Verhältnisse zu verhindern. So fanden sich auch in der SBZ/DDR Menschen, die Bevormundung und Entrechtung durch das SED-Regime nicht hinnehmen wollten und zu oppositionellem Handeln bereit waren. Im Laufe der Jahrzehnte veränderten sich ihre Stärke, Ziele und Aktivitäten. Während sich bis zum Mauerbau 1961 viele Widerstandsaktionen grundsätzlich gegen das kommunistische System richteten und die Abschaffung der DDR anstrebten, setzten sich in den 1970er und 1980er Jahren Oppositionelle vor allem für die Reformierung des Sozialismus und die Liberalisierung der bestehenden Gesellschaft ein.
Abgesehen vom Volksaufstand im Juni 1953 und den großen Demonstrationen im Herbst 1989 waren es oft nur kleine Gruppen, die tatsächlich aktive Oppositionsarbeit leisteten. Häufig angesiedelt unter dem schützenden Dach der Kirchen, diskutierten sie in Arbeitskreisen, druckten Flugblätter, verteilten illegale Publikationen oder führten Protestaktionen wie Unterschriftensammlungen durch. Ein System vielgestaltiger Repressionen sorgte dafür, dass aber nur wenige Menschen den Mut fanden, sich offen gegen die SED-Diktatur zu stellen. Schon das Tragen eines Aufnähers mit der Aufschrift „Schwerter zu Pflugscharen“ konnte schwerwiegende Konsequenzen haben.
Ausgelöst durch das Wirken der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung „Solidarność“ in Polen, den Machtantritt des Reformers Michail Gorbatschow in der Sowjetunion und die wachsende innenpolitische Gesellschaftskrise in der DDR erhielt die ostdeutsche Oppositionsbewegung seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre immer größeren Zulauf. Im Herbst 1989 entwickelten sich die politisch-alternativen Kreise zusammen mit den Kirchen zu den wichtigsten Kristallisationspunkten für die Massendemonstrationen gegen das SED-Regime.